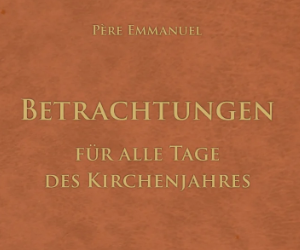Die Erfahrung, dass auch noch so gut begründete Programm-Beschwerden von den ARD-Anstalten abgewimmelt werden, hat nicht nur der Frankfurter Katholikenkreis gemacht. Solche Beteuerungen, wie wir sie in einem Schreiben vom SWR bekamen, wirken äußerst floskelhaft: Die Programmbeschwerde sei ein hohes öffentlich-rechtliches Gut und man würde sich intensiv mit der Kritik an der Berichterstattung auseinandersetzen.
Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.
Das hohe Gut der Beschwerde wird unerreichbar hoch gehängt
Jedenfalls drängt sich bei den knappen Ablehnungsbescheiden mit pauschalen oder gar fehlenden Begründungen der Verdacht auf, dass die Kritiker und ihre Argumentationen von den ARD-Verantwortlichen doch nicht so ernst genommen werden, wie sie es behaupten. Sie vermitteln mit den einstimmigen Zurückweisungsbeschlüssen den Eindruck, als wenn bei ARD-Sendungen jeder Fehler auszuschließen wäre. An Inhalt und Niveau der Sendungen lassen sie nicht den Hauch von Kritik zu.
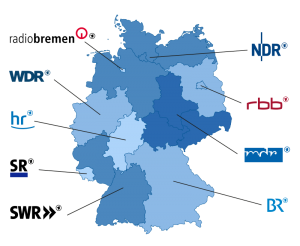
Dabei müssten Intendanten, Sender- und Programmdirektoren ein ureigenes Interesse daran haben, Argumente und kritische Hinweise zur Qualitätsverbesserung ihres Sendeprogramms zu nutzen.
Die neue ARD-Vorsitzende, Frau Prof. Wille vom MDR, hat in ihrer Einführungsrede dazu einige treffende Bemerkungen gemacht: Aus der Gemeinschaftsfinanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender ergäben sich hohe Ansprüche an die Programmgestaltung. Dafür seien Glaubwürdigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz notwendig. Um die zu erreichen, müssten die Sender einen kontinuierlichen und wahrhaftigen Dialog mit den Zuschauern führen sowie umfassende Transparenz im journalistischen Handeln an den Tag legen. Von großer Bedeutung sei dabei auch eine Fehlerkultur, die von Offenheit und der Fähigkeit zur Selbstkritik gegenüber den Beitragszahlern bestimmt sei.
Nach unseren Erfahrungen ist den Sendern das Bemühen um den Dialog mit kritischen Zuschauern vorhanden, aber von Fehlerkultur oder gar der Fähigkeit zur Selbstkritik sind nicht einmal Ansätze zu spüren. Es sieht eher danach aus, als wenn sich Sendeanstalten auf allen betroffenen Ebenen – also Intendanz, Rundfunkrat und Fachredaktionen – in Korpsgeist oder Wagenburgmentalität einigeln, um alle kritischen Einwände abzukanzeln. Die institutionellen Bedingungen dieser Kritikabweisung ist im sechsten Serienteil am Beispiel des SWR aufgezeigt worden.
Ist es unter diesen Umständen noch sinnvoll, Beschwerden zu schreiben?
Unter diesen Bedingungen scheint es keinen Sinn zu haben, Zeit und Energie in detaillierte und umfassende Beschwerdeschreiben zu stecken. Denn die werden vom entscheidenden Rundfunkrat offenbar nur oberflächlich behandelt und debattiert, jedenfalls in ihren einzelnen Argumentationsschritten nicht vertiefend besprochen. Das Debattenergebnis mit stets hundertprozentiger Beschwerdeablehnung resultiert einerseits aus dem Mangel an journalistischer Beurteilungskompetenz bei den Ausschuss-Mitgliedern sowie dem oben beschriebenen Korporationsgeist der Rundfunkanstalt andererseits.
Gleichwohl bleibt es nach unserer Ansicht wichtig und notwendig, bei anti-kirchlichen Tendenzen oder Verstößen gegen die journalistische Fairness Beschwerden einzureichen. Sendekritiken bleiben aus zwei Gründen wichtig: Zum einen sollen die jeweiligen Anstalten bzw. Redaktionen wissen, dass sie kritisch beobachtet werden. Zum andern ist bei Publizierung der Auseinandersetzung eine gewisse Gegenöffentlichkeit erreichbar.
Längerfristig sollten die medienkritischen Kräfte auf eine Reform des Beschwerdeverfahrens in den öffentlich-rechtlichen Anstalten hindrängen.
Analyse und Reformvorschläge für ein effektives ARD-Beschwerde-Verfahren
Dazu hat der Medienwissenschaftler Hans Matthias Kepplinger schon entscheidende Hinweise gegeben. Er stellt fest, dass die Beschwerdeausschüsse der jeweiligen Rundfunkräte von zwei Seiten in die Zange genommen würden:
Die Fachredaktionen würden bei Kritik als verschworene Gemeinschaft reagieren und ihre Beiträge mit Vehemenz verteidigen. Danach erwarten sie, dass der Rundfunkrat sich mit ihnen solidarisiert.
Von Seiten der Intendanz stünden die Beschwerdeausschüsse ebenfalls unter dem Erwartungsdruck, das Ansehen von Sender und Sendungen nicht unnötig anzukratzen.
Die Rundfunkräte selbst seien dieser doppelten Erwartungshaltung nicht gewachsen – und das wegen weiterer Bedingungen:
Die Rundfunkratsmitglieder sind keine journalistischen Fachleute, die die Fehler und Schwächen der kritisierten Sendungen analysieren und erkennen könnten. Sie haben folglich auch nicht die Kompetenz, die Schwachpunkte der redaktionellen Rechtfertigungstexte zu durchschauen.
Des Weiteren fehlt den Rundfunkräten der Status wirklicher Unabhängigkeit für eine Kontrollbeauftragung. Sie sind eigentlich ein bunter Haufen von Lobbyisten, die ihre jeweilige Interessengruppe in der Sendeanstalt vertreten sollen.
Orientierung an dem effektiven Beschwerdeverfahren des Deutschen Presserats
Professor Kepplinger verweist als Alternativ-Modell auf die Institution des Deutschen Presserats, der gegenüber den privatwirtschaftlichen Medien seine Kontrollfunktion zufriedenstellender verwirklicht. Eine Reform des Beschwerdewesens sollte sich an den Verfahren des Presserats orientieren:
- Dem Rundfunkrat bzw. Beschwerdeausschuss müsste eine unabhängige Fachgruppe zur Seite gestellt werden, die mit journalistischen Fachleuten zu besetzen ist. Die hätte die jeweilige/n Beschwerde/n, die kritisierte Sendung und die Rechtfertigungsschreiben der Redaktion fachkritisch zu prüfen und zu bewerten. Als Ergebnis ihrer Arbeit würde sie eine begründete Beschlussempfehlung für die Letzt-Entscheidung des Rundfunkrats erstellen.
- Für eine effektive und transparente Arbeitsweise von Fachgruppe und Beschwerdeausschuss wären klare Kriterien und Regelungen vonnöten. Jedenfalls braucht es dafür ein differenzierteres Statut als die bisherigen staatsvertraglichen Vorschriften, die auf die allzu knappe Formel eines unabhängigen, objektiven und ausgewogenen Journalismus’ gebracht werden.
- Nach der Entscheidung, eine Beschwerde als begründet anzuerkennen, müsste eine Zuordnung zu unterschiedlichen Schweregrade der Verstöße vorgenommen werden. Der Deutsche Presserat hat dafür die Sanktions-Kategorien Hinweis, Missbilligung und Rüge festgelegt. Eine entsprechende Differenzierung sollte auch die ARD entwickeln.
- Schließlich ist für Transparenz und Öffentlichkeitskontrolle die Publikation der Beschwerde-Entscheidungen relevant. Analog dem Jahrbuch des Presserats, in dem alle Verfahrensergebnisse veröffentlicht werden, sollten die ARD-Sendeanstalten begründete Kritik an Sendungen publizieren.
Es ist allerdings klar, dass diese Vorschlagsziele für eine grundlegende Reform des Beschwerdeverfahrens in absehbarer Zeit nicht erreicht werden kann. Denn dafür müssen viele Diskussionen geführt sowie Positionen und Parteien vermittelt werden. Insofern kann der Vorschlag nicht viel mehr als die Richtung für einen Diskussionsanstoß angeben, aber auch nicht weniger.
Reformvorschläge, die kurzfristig zu realisieren sind
Auf diesem Hintergrund sollte man über Alternativen nachsinnen, die kurzfristig und im Rahmen der bestehenden Staatsverträge verwirklicht werden könnten:
- Die Intendanz müsste sich vor der Diskussion im Rundfunkrat zurückhalten mit einer abschließenden Bewertung der Beschwerde/n – erst recht nicht ein pauschales und kategorisches Urteil abgeben. Die verfahrensmäßig vorgeschriebene Antwort der Intendanz sollte ausdrücklich als die Ansicht einer Seite gekennzeichnet werden, die anderen Bewertungen nicht im Wege steht.
- Man könnte für die Programmausschussmitglieder journalistische Schulungen ansetzen, damit die für ihre Aufgabe, Sendungen und Beschwerdeschreiben zu analysieren und zu bewerten, besser gerüstet sind.
- Dem Vorstand des Programmausschusses sollte das Recht eingeräumt werden, ein Fachgutachten von unabhängiger Seite anfordern zu können, auf dessen Basis die Mitglieder des Gremiums ihre Diskussion und Entscheidung stützen können.
- Man könnte zu dem Verfahren einen Fachjournalisten als „Anwalt der Beschwerdeführer“ hinzuziehen, der den Programmausschussmitgliedern die Beschwerde-Argumentation bzw. Kritik an der betreffenden Sendung erläutert und für Fragen zur Verfügung steht, bevor dann das Gremium weiter berät.
- Die Programmgrundsätze der jeweiligen Landesstaatsverträge als Bewertungsgrundlage des Beschwerdeausschuss‘ sollten als übersichtliche und klare Aussagen für die Gremiumsmitglieder neu formuliert werden, um zu einer differenzierteren Diskussionsgrundlage zu kommen, als es die Formel von der ausgewogenen, neutralen und objektiven Berichterstattung darstellt.
- Im Sinne einer differenzierten Bewertung sollte es auch möglich werden, dass der Programmrat jeweils einzelne Kritikpunkte der Beschwerde/n begründet als berechtigt oder unberechtigt qualifiziert – unabhängig von dem Gesamturteil.
- Es müsste allen Sender-Verantwortlichen zu denken geben und die Dringlichkeit von Reformen anzeigen, dass die meisten Beschwerden zu umstrittenen Sendungen stets einstimmig und ohne Enthaltung abgewiesen werden. Durchgehend hundertprozentige Abstimmungsergebnisse in demokratischen Gremien weisen nach unserer Ansicht auf vorliegende institutionelle Mängel hin. Jedenfalls sind sie nicht Ausdruck einer wahrhaftigen und offenen Fehlerkultur, wie sie von der neuen ARD-Vorsitzenden angemahnt worden ist (siehe oben).
Sowohl diese Verfahrensvorschläge wie auch die obigen Anregungen für eine institutionelle Reform des Beschwerdewesens laufen darauf hinaus, die Aufarbeitung von Beschwerden zu professionalisieren. Nach unserem Dafürhalten müssten solche Reformschritte auch im Interesse der ARD-Verantwortlichen liegen. Denn die ernsthafte Auseinandersetzung mit externer qualifizierter Kritik wird zur Qualitätsverbesserung in der journalistischen Arbeit beitragen.
Text: Hubert Hecker
Bild: Wikicommons