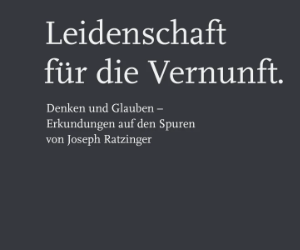von Roberto de Mattei*
Im Rahmen des Angelus vom 28. August kündigte Papst Franziskus an, daß er „sobald als möglich“ sich in das von einem Erdbeben erschütterte Gebiet in den italienischen Regionen Latium, Umbrien und den Marken begeben wird, um den betroffenen Menschen „die Stärkung des Glaubens, die Umarmung des Vaters und Bruders und die Unterstützung der christlichen Hoffnung“ zu bringen.
Jenes „sobald als möglich“ hat nicht mit den Verpflichtungen des Papstes zu tun, der sofort aufbrechen wollte, sondern mit den Such- und Aufräumarbeiten der Feuerwehren, des Zivilschutzes und der Ordnungskräfte, die er durch seinen Besuch in der jetzigen Phase nicht behindern möchte. Der Vatikanist Andrea Tornielli erinnerte daran, daß der Blitzbesuch von Johannes Paul II. in Kampanien und der Basilikata, 48 Stunden nach dem Erdbeben vom 23. November 1980, heftige Polemiken ausgelöst hatte. Damals behaupteten manche, Johannes Paul II. hätte damit die auf Hochtouren laufenden Rettungsaktionen behindert und die Ordnungskräfte von wichtigeren Aufgaben abgezogen. Benedikt XVI. warteten daher 22 Tage, bevor er die vom Erdbeben des 6. April 2009 zerstörte Stadt L’Aquila aufsuchte, und 36 Tage, bevor er in die Emilia reiste, die am 20. Mai 2012 von einem starken Beben erschüttert worden war.
Die Entscheidung, den Besuch zu verschieben, scheint daher aus verschiedenen Gründen richtig. In den ersten Wochen nach einer solchen Katastrophe, brauchen die Erdbebenopfer vor allem materielle Hilfe: Nahrung, Kleidung und viele ein Dach über dem Kopf. In den darauf folgenden Monaten, wenn ihre Lage keine Schlagzeilen mehr macht, fühlen sie sich erst richtig verlassen und brauchen geistliche und moralische Unterstützung. Niemand kann diese Hilfe, die vor allem darin besteht, die Betroffenen daran zu erinnern, daß alles im christlichen Leben einen Sinn hat, auch die schlimmsten Katastrophen, besser bringen als der Papst.
Das ist die Antwort, die jenen zu geben ist, die – wie Eugenio Scalfari in La Repubblica vom 28. August – das Erdbeben von Amatrice und alle anderen Übel dieser Welt zelebriert und nach dem Grund nicht nur des Erdbebens, sondern des Chaos in der heutigen Welt fragt, und eine Antwort in einem kosmischen Pessimismus sucht. Es sind auch die Vorwürfe des Geltungsdranges zu vermeiden, die unweigerlich jene treffen, die – wie Papst Franziskus – das Scheinwerferlicht der großen Bühne etwas zu sehr lieben, der in den vergangenen Tagen mit Filmaufnahmen in den Vatikanischen Gärten beschäftigt war, um – wie es scheint – für einen Film sich selbst darzustellen, obwohl der Vatikan noch im vergangenen Februar dementiert hatte, daß Papst Bergoglio die Absicht habe, das Darsteller in einem Film mitzuwirken.
Was an Scalfaris Kommentar stimmt ist die Tatsache, daß die Erdbebentragödie sich in eine stürmische internationale Situation einfügt. Die ersten Seiten der Tageszeitungen waren in der vergangenen Woche vom Erdbeben in Italien belegt, so wurde einer anderen, besorgniserregenden Nachricht kaum Aufmerksamkeit geschenkt: der Aufforderung der deutschen Bundesregierung an die Bürger, mit Blick auf eine eventuelle nationale Katastrophe, Lebensmittelvorräte anzulegen.
Die Gläubigen erwarten sich, daß der Papst daran erinnert, daß materielle Unglücke den Körper schädigen und zerstören können, daß es aber noch schwerere spirituelle und moralische Katastrophen gibt, die die Seelen schädigen können. Die Katholische Kirche selbst ist heute in ihrem Inneren durch ein Erdbeben erschüttert.
Im Internet wurden Fotos einer Marienstatue veröffentlicht, die auf wundersame Weise inmitten einer zerstörten Kirche von Arquata del Tronto unbeschädigt blieb. Die Anrufungen der Gottesmutter haben unter den Erdbebengeschädigten stark zugenommen, und Antonio Socci hat sich zum Wortführer der Bitte einiger Katholiken an Kardinal Angelo Bagnasco, den Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz gemacht, die Weihe Italiens an das Unbefleckte Herz Mariens zu erneuern.
Die Gottesmutter hatte aber keinen Platz beim Meeting von Comunione e Liberazione (CL) in Rimini, wo sie von einem Stand entfernt bzw. verhüllt werden mußte. Die Marienverehrung scheint unvereinbar mit der ökumenisch-interreligiösen Umarmung von Muslimen und Protestanten.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana