Ist das mehrjärige Lektionar des Novus Ordo, das eine weit größere Anzahl von Schriftlesungen umfasst, dem alten einjährigen Lektionar des usus antiquior überlegen? Für eine sehr lange Zeit wurde diese Frage kaum ernstgenommen, da man annahm, darauf mit einem offensichtlichen „ja“ antworten zu können. Es ist daher erfreulich zu sehen, dass sich mehr und mehr Leute der Ernsthaftigkeit dieser Frage bewusst werden und Vergleiche und Studien anstellen, anstatt auf eine unverwechselbar moderne Art anzunehmen, dass mehr grundsätzlich besser ist.
Vielmehr hat mich jahrzehntelange Erfahrung mit beiden Lektionaren zur entgegengesetzten Schlussfolgerung geführt: Das neue Lektionar ist schwerfällig, und man kann sich nur schwer damit arrangieren, während der alte Zyklus der Lesungen wunderschön proportioniert ist angesichts seines liturgischen Zwecks und des natürlichen Rhythmus des Jahres. Die regelmäßige und tröstliche Wiederkehr der Lesungen hilft dem Kirchgänger, ihre Lehren noch nachhaltiger aufzunehmen.
Derjenige, der in die traditionelle Liturgie eintaucht, erkennt, dass die jährlichen Lesungen mit der Zeit Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch werden. Man beginnt, über bestimmte Monate und Jahreszeiten, bestimmte Sonntage oder Gruppen von Heiligen zusammen mit den jeweiligen feststehenden Lesungen nachzudenken, die der frommen Seele ihre Bedeutung mehr und mehr öffnen. Wenn das Wort Gottes eine unendliche Tiefe hat, lädt uns die traditionelle Liturgie ein, Jahr für Jahr vor demselben Brunnen zu stehen, unseren Eimer hinunterzulassen, und auf diese Weise der unerschöpflichen Tiefe gewahr zu werden, die vielleicht nicht so offensichtlich ist für jemanden, der seinen Eimer über zwei oder drei Jahre an verschiedenen Orten in den Strom taucht.
Der Zusammenhang konkreter Lesungen mit konkreten Heiligen oder Gruppen von Heiligen in allen traditionellen westlichen liturgischen Riten ist eine intelligente und weise Einrichtung. Indem er bestimmte Lesungen und Evangelien wieder und wieder vernimmt, kann der Katholik leichter ihre Bedeutung aufnehmen und wird wirklich vertraut mit dem Wort Gottes, wie es illustriert und uns lehrt über den Triumph unseres Herrn, unserer lieben Frau und der Heiligen Gottes.
Das Ziel des christlichen Glaubens ist nicht eine materielle Kenntnis der Heiligen Schrift, sondern persönliche Heiligung und Bekehrung, was der formale Inhalt und das Ziel der Schrift selbst ist. Auf eine besondere Weise werden die Heiligen vorgestellt als Beispiel für uns, wie man leben soll, wie man glauben soll, wie man lieben soll, und die Heilige Schrift ist richtigerweise in den Dienst dieser Absicht gestellt.
Das Ziel der Liturgie ist nicht, uns mit der Heiligen Schrift vertraut zu machen wie ein Bibelkreis – was außerhalb der Messe natürlich geschehen sollte –, sondern uns die richtige Bildung des Verstandes zu geben bezüglich der Wirklichkeiten unseres Glaubens. Die grundlegenden Elemente des Glaubens müssen Woche für Woche, Tag für Tag eingeprägt werden; und daher ist es pädagogisch höchst angemessen, dass gewisse Lesungen jährlich wiederholt werden, beispielsweise die Epistel und das Evangelium für die verschiedenen Sonntage nach Pfingsten, die Lesungen der Osterwoche, die Lesungen für bestimmte Kategorien von Heiligen. Auf diese Weise wird das christliche Volk geformt mittels der Verkündigung fundamentaler Texte den Jahreskreis hindurch, anstatt jeden Tag in immer neue Textregionen entführt zu werden – besonders einige der trockeneren historischen Schilderungen oder längere Abschnitte der Propheten, von denen man vielleicht nur schwer profitieren kann, abgesehen von außerliturgischem Studium.
Beispielsweise besteht das liturgische Ziel, die Propheten zu lesen, darin, auf klare und deutliche Art auf Christus und die Kirche hinzuweisen. Um dieses Ziel zu erreichen ist es mehr als ausreichend, die eindrucksvollsten und lehrreichsten Abschnitte auszuwählen und sie beständig zu verwenden. Wir holen spirituell viel mehr aus einer inspirierten Passage, die uns vertraut wird, als aus einem langfristigen Zyklus, der eine Menge Schriftlesungen „durchbekommen“ will.
In diesem Sinne lesen wir jedes Mal, wenn wir das Fest eines heiligen Papstes im traditionellen römischen Ritus feiern, die berühmten Verse aus Matthäus 16, welche die fundamentale Berufung des Papstes zeigen und das Ideal, dem er zu entsprechen hat, sowie uns einladen, uns wieder dem Papsttum zu verpflichten als dem von Christus eingesetzten Fels, auf dass seine Kirche niemals untergehe, wenn sie durch die Angriffe Satans angeschlagen ist.
Ein anderes Beispiel (für mich eines der bewegendsten überhaupt): Am 4. Mai, dem Fest der heiligen Monika im usus antiquior, spricht der heilige Paulus in der Epistel der Messe von der Ehre, die wahren Witwen gebührt (diese Lesung teilt Monika mit anderen heiligen Witwen), aber das eigens ausgewählte Evangelium erzählt, wie Jesus den Sohn der weinenden Witwe von den Toten auferweckte und ihn seiner Mutter zurückgab. Welches Evangelium wäre perfekter für die Mutter des heiligen Augustinus? Was könnte unserem Verstand sowohl das Evangelium als auch Monikas Leben besser einprägen als diese bemerkenswerte Juxtaposition? Jedes Jahr während ihres Verweilens auf der Erde – ganz gleich wie viele tausend Jahre vergehen – gedenkt die Kirche der Mutter, die nie den Glauben an Gott verloren hat und schließlich ihren Sohn zurückgewann – tot in Sünde und Irrtum, auferstanden im Leben der Gnade.
Auf diese Weise ist die gesamte Liturgie gewirkt als ein nahtloses Gewand. Die Gebete ehren den Heiligen und rufen ihn an; die Lesungen rühmen die Tugenden des Heiligen, der als unser Beispiel und Lehrmeister vorgestellt wird; das eucharistische Opfer verbindet deutlich die triumphierende Kirche, repräsentiert durch die Aufzählung der Heiligen im römischen Kanon, mit uns Pilgern in der streitenden Kirche. Die ganze Liturgie erlangt eine Einheit der Heiligung, indem sie uns sowohl den ursprünglichen Weg der Heiligkeit zeigt – Jesus in der heiligen Eucharistie – als auch die Beispiele verwirklichter Heiligkeit – die Heiligen.
Im Gegensatz dazu sind in der neuen Liturgie die Gebete, die Lesungen und die Eucharistie unbeholfen einander gegenübergestellt – sie passen nicht länger zusammen in eine einzige „Erzählung“. Die etwas mechanische Verwendung der Heiligen Schrift ist äußerlich und akzidentell hinsichtlich der Feier der meisten Heiligenfeste, in Spannung zum tatsächlichen Zweck der Heiligen Schrift, der nicht in einfacher Kenntnis derselben besteht, sondern in der lebendigen Anwendung auf unser Leben, vermittelt durch die Leben jener, die gelebt haben, was die Heilige Schrift lehrt und sie somit inkarnieren. Die Heiligen sind, so könnte man sagen, die Heilige Schrift in Fleisch und Blut, und aus diesem Grund beruft man sich so angemessen auf das geschriebene Wort, um ihnen zu Diensten zu sein und ihren existenziellen Vorrang zu reflektieren. Wenn die Feste von Jungfrauen gefeiert werden, wählt die traditionelle Liturgie jene Lesungen, welche die Schönheit und Erhabenheit der Berufung zur Jungfräulichkeit hervorheben; und ebenso verhält es sich mit anderen Festen.
Die Heilige Schrift für sich allein ist toter Buchstabe. Es sind sind die Heiligen, die der höchste Beweis und der herrlichste Ausdruck des christlichen Glaubens sind. Die Heiligen zeigen, dass die Heilige Schrift kein toter Buchstabe ist, sondern ein lebendiges Beispiel. Wir müssen die Funktion der Heiligen Schrift in der Messe verstehen in Bezug auf ihre Ausgestaltung im Leben der Heiligen.
Eine breitere Auswahl an Lesungen hätte in das alte Messbuch inkorporiert werden können (und das kann immer noch geschehen), ohne die Wechselbeziehungen zu zerstören, die ich verteidige. Es könnte eine üppigere Verteilung passender Lesungen geben für Märtyrer, Jungfrauen, Päpste, Bekenner, Kirchenlehrer usw. Doch selbst bei einer solchen Verteilung wird die tiefe Einheit der Liturgie perfekt bewahrt, wenn die gebührende Harmonie von Gebeten, Antiphonen, Lesungen und Ordinarium durchweg respektiert wird. Besondere Proprien und Lesungen könnten für bestimmte Heilige festgelegt werden, die kontemplative Berufung des einen oder die missionarische Berufung des anderen hervorhebend; aber wiederum mit einem Blick auf die Ganzheit der Liturgie als ein Zusammenkommen der Gemeinschaft der Heiligen, um den bereits errungenen Sieg und den noch zu erringenden Sieg zu feiern.
Grundsätzlich ist nichts falsch an einer breiteren Auswahl an Lesungen, sofern die oben zusammengefassten liturgischen Richtlinien mit Sorgfalt beachtet werden. Das Problem besteht vielmehr in einer freischwebenden (vom Heiligenkalender unabhängigen) rationalistischen Abfolge von Schriftlesungen, die nur wenig leistet hinsichtlich einer tiefen Unterweisung und Erhellung des Geheimnisses der Heiligen, der Auserwählten Gottes, denen wir uns anzugleichen haben, während wir danach streben, durch die Gnade dem höchsten Heiligen Gottes angeglichen zu werden – Jesus Christus.
Originaltitel: Is Reading More Scripture at Mass Always Better?/ Übersetzung M. Benedikt Buerger
Bild: newliturgicalmovement.org
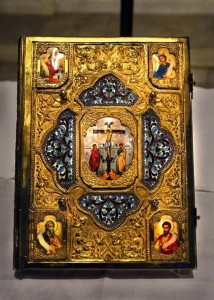
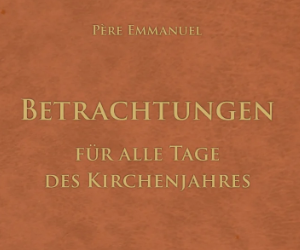

Danke für diesen schönen und tiefgründigen Artikel!
Ich hatte die Freude, Herrn Kwasniewski einmal persönlich kennenzulernen. Er ist ein gutes Beispiel für einen Laien, der Familie und Beruf, Frömmigkeit und Intellektualität gut zusammenbringt.
Von ihm gibt sehr gute Aufsätze in The Latin Mass.
Wenn der verdienstvolle Übersetzer ohnehin schon an diesen Texten dran ist, sei er hiermit in seinem Tun ausdrücklich ermutigt!
Zu berücksichtigen ist auch, dass der Idealfall der ist, dass eine Schola vorhanden ist, die auch das Proprium singt und dabei sind weitere Bezüge zwischen den einzelnen Sonntagen und Festen festzustellen. Einmal eine Wechselbeziehung zwischen Melodie und Text, wobei durch die Melodie den Text interpretiert wird (ein geläufiges Beispiel, das jeder kennt, im Ordinarium die aufstrebende Tonfolge „ascendit“ im Credo) und darüber hinaus eine musikalische Wechselbeziehung innerhalb des Kirchenjahres(!) Hieran sieht man sehr schön die organische Einheit, die den alten Ritus ausmacht. Ein Kirchenmusiker kann dies viel besser erklären als ich, aber ich möchte den Hinweis geben. Alleine die Tatsache, dass jeder Sonntag und jedes Fest über eigene Musik verfügt ist staunenswert.
Werte @Teresa,
wir haben in Münster das Glück (diesen Idealfall), eine solche Form der Hochämter (seit Januar 1998) in der St. Aegidiikirche an Sonn- und Feiertagen (9:30 Uhr) erleben zu dürfen. Und ich selbst darf seit Anbeginn mit in dieser Schola das Proprium und das Ordinarium singen. Es gibt auch schon mal Leute, die extra von weither nach Münster fahren, um diese Liturgie erleben zu können; ich weiss von jemandem, der gelegentlich extra aus Wilhelmshaven anreist, andere aus dem Emsland.
In der Anfangszeit wurde die Schola von einem profunden Kenner der Materie (ehemaliger Lehrer an der Kirchenmusikschule: Bernhard Terschluse sen., inzwischen verstorben) gegründet und mehr als 10 Jahre geleitet. Und so haben die (noch verbliebenen) Mitglieder aus dieser Anfangszeit eine gute feste Grundlage der Gesänge, so dass heute nur noch vor der jeweiligen Hl. Messe eine gute halbe Stunde geprobt werden muss. Diese Schola hat dann immer wieder mal (im nördlichen Bereich: Essen, Kevelaer, Münster, …) bei „Pro Missa Tridentina“ – Tagungen jeweils beim Pontifikalamt gesungen, jeweils dann unterstützt von z. B. Bielefelder Sängern.
Wenn man diese Musik seit vielen Jahren immer wieder mit singen darf, dann ‚erlebt‘ man diese großartige Ordnung geradezu. Da ich auch werktags seit etwa zwei Jahrzehnten im Novus Ordo zur Hl. Messe gehe, ist mir der Unterschied zwischen beiden Arten der Ordnung sehr bewusst; (und oft auch sehr schmerzhaft im Novus Ordo durch die vielfältigen ideologischen Abänderungen der Texte der Hl. Messe durch die jeweiligen Priester).
Die alte Ordnung der jährlichen Wiederholung scheint mir auch einsichtiger zu sein, da das Wort Gottes eine ungeahnte Tiefe hat, die wir gerade durch die häufigere Betrachtung und gleichzeitige immer stärkere Bemühungen um Selbstheiligung dann vom Heiligen Geist aufgeschlossen bekommen („Selig, die reinen Herzens sind (sich darum bemühen), denn sie werden Gott schauen“- Gott gibt uns unter den o. g. Voraussetzungen Einblicke in seine Geheimnisse).
Unter solchen oder ähnlichen Voraussetzungen kann man auch spüren, dass diese Gregorianischen Gesänge göttlichen Ursprungs sind; im Gegensatz zu vielen neuen Liedern im Novus Ordo die wohl nicht aus ‚Knieender Theologie‘ entstanden sind. Text und Musik der „Gregorianischen Gesänge“ (in unseren Hochämtern in St. Aegidii in Münster) sind eine wunderbare Einheit in sich selbst, aber auch zusammen mit der gesamten Liturgie des jeweiligen Sonntages oder Festtages des Usus Antquior. Es ist immer wieder eine große Freude dieses erleben und dabei mitwirken zu dürfen.
Ja schon, weil in Österreich wird die zweite Lesung in der Messe nicht gelesen und dafür so mehr Tango gemacht, da ist es besser eine 2. Lesung zu lesen, und die Messe verlängert man ja nicht beliebig, so viel Zeit hat man für den Lieben Gott nicht!
Den ganzen Reichtum der Liturgie und der Texte erschlie0t sich ohnehin nur in der Überlieferten Liturgie! Und dazu gehört auch das Brevier!
Es gibt keinen Grund, die tridentinische Liturgie zu verändern. Verändert werden müsste stets nur unsere Haltung.
Wenn immer von den Verfechtern der modernen Liturgie behauptet wird, früher hätten die Omis ja nicht kapiert, was in der Messe so angeht und währenddessen Rosenkränze gebetet, so ist das sicher ein wesentlicher Kritikpunkt. Gerade vorhin war ich in einer tridentinischen Messe, und es stört sehr, wenn wir allesamt Osterlieder schmettern, während der Priester am Altar zelebriert. Das ist sicher nicht das Gelbe vom Ei (gewesen). Aber schlimmer als die NO-Zustände kann das wohl kaum angesehen werden: dort wird unentwegt gequatscht, auch fromm gequatscht, und es rieselt durch die Leute durch wie durch grobmaschige Siebe.
Verändert werden müsste unsere Haltung – das heißt: gute Katechese von klein auf (völlig undenkbar derzeit!). und im übrigen kann niemand ein guter Christ sein, wenn er sich nur während der Hl. messe mit dem Glauben beschäftigt. Jeder Katholik sollte auch sonst beten. Rosenkranz, Brevier, freie Gebete, den Angelus. Und das Lesen der Bibel gehört eigentlich auch wesentlich dazu.
Wenn ich zur Hl. Messe gehe, sollte man bei mir schon einiges voraussetzen können.