 (Vatikan) Schritt um Schritt, Ansprache um Ansprache, liefert Papst Benedikt XVI. der katholischen Kirche die Elemente für eine Neuinterpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die in Rom tagenden Synodenväter wissen, daß eine Neuevangelisierung kaum möglich ist, wenn es keine klare Vorstellung darüber gibt, was das Konzil war. „Jenes Ereignis, das die Kirche in die Eingeweide der modernen Welt gestoßen hat“, so der Vatikanist Paolo Rodari.
(Vatikan) Schritt um Schritt, Ansprache um Ansprache, liefert Papst Benedikt XVI. der katholischen Kirche die Elemente für eine Neuinterpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die in Rom tagenden Synodenväter wissen, daß eine Neuevangelisierung kaum möglich ist, wenn es keine klare Vorstellung darüber gibt, was das Konzil war. „Jenes Ereignis, das die Kirche in die Eingeweide der modernen Welt gestoßen hat“, so der Vatikanist Paolo Rodari.
Am Mittwoch verließ der Papst für zwei Stunden den Synodensaal, um bei der Generalaudienz eine Katechese zu halten, die reich an persönlichen Erinnerungen an das Konzil war. Benedikt XVI. sprach von „seinem“ Konzil, das Johannes XXIII. einberufen hatte, „um den Glauben auf eine erneuerte, prägnantere Weise sprechen zu lassen, dabei aber an seinen ewiggültigen Inhalten ohne Nachgeben und ohne Kompromisse festzuhalten“.
Weil dies offensichtlich in der Nachkonzilszeit durch andere Gesichtspunkte überlagert wurde, sei das Konzil erst wirklich zu entdecken. Dies kann laut Benedikt XVI. nur über dessen Dokumente geschehen: „Wir müssen sie befreien von jener Masse von Publikationen, die sie verdeckt haben, statt sie bekannt zu machen.“
Wenige Minuten bevor der Papst diese Worte sprach, wurde der Text veröffentlicht, den er im vergangenen Sommer in Castel Gandolfo für den 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils verfaßt hatte. Es handelt sich um die Einleitung zu seinen Konzilsschriften, die vom Herder Verlag veröffentlicht werden und in einer Sondernummer des Osservatore Romano im Vorabdruck erschienen ist.
Dem Zweiten Vatikanischen Konzil gingen andere Konzile voraus, heißt es im Text, die einberufen worden waren, „um grundlegende Elemente des Glaubens zu definieren und vor allem, um Irrtümer zu korrigieren, die den Glauben bedrohten“. Das Konzil von Nizäa von 325 widersetzte sich der arianischen Häresie. Das Konzil von Ephesos von 431 verkündete das Dogma der Gottesmutterschaft Mariens. Das Konzil von Kalzedonia von 451 bekräftigte die eine Person Christi in zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen. Das Konzil von Trient, das 1545 begann, antwortete auf die protestantische Kirchenspaltung. Das Erste Vatikanische Konzil bekräftigte die Unfehlbarkeit des Papstes bei der Verkündung eines Dogmas.
Das Zweite Vatikanische Konzil aber sei etwas ganz anderes gewesen, so Benedikt XVI. „Als es einberufen wurde, gab es keine besonderen Glaubensirrtümer zu korrigieren oder zu verurteilen, noch Fragen der Glaubenslehre zu klären.“ Es gab hingegen die Notwendigkeit, „auf neue Weise das Verhältnis zwischen der Kirche und der Moderne, zwischen dem Christentum und einigen grundlegenden Elementen des modernen Denkens“ abzustecken, „nicht um sich diesem anzupassen, sondern um dieser unserer Welt, die dazu neigt sich von Gott zu entfernen, aufzuzeigen, daß sie des Evangeliums in seiner ganzen Größe und Reinheit bedarf.“
Benedikt XVI. erinnerte an Johannes XXIII., der bei der Eröffnung des Konzils „ein Christentum vor sich hatte, das immer an Kraft zu verlieren schien“. Deshalb die Notwendigkeit eines „aggiornamento“. Eine Aufgabe, die allerdings „von den einzelnen Episkopaten“ auf unterschiedliche Weise interpretiert wurde. Der deutsche Episkopat zielte auf den Ökumenismus ab, andere mehr auf die Ekklesiologie. Ein wichtiges Thema für die mitteleuropäischen Bischöfe war „die liturgische Erneuerung“.
Das Schlüsselthema berührten jedoch die französischen Bischöfe, „das sogenannte Schema XIII, die Beziehungen zwischen Kirche und modernen Welt“, so Benedikt XVI. „Die Kirche, die in der Barockzeit im wahrsten Sinn des Wortes die Welt geformt hatte, war seit dem 19. Jahrhundert in eine negative Beziehung zur Moderne getreten. Sollten die Dinge so bleiben?“ Das Konzil antwortete mit Nein und tat dies vor allem mit zwei Dokumenten. Jenem über die Religionsfreiheit, in dem die Lehre Pius XII. der bloßen Tolerierung mit dem Konzept des Rechts den eigenen Glauben zu wählen, überwunden wurde. Und dem zweiten Dokument über die Beziehungen zu den nicht-christlichen Religionen. Der Rezeptionsprozeß dieses Dokumentes „Nostra Aetate“ zeige eine „Schwäche“, so Benedikt XVI. „Er spricht über die Religion als etwas positives und ignoriert die kranken und gestörten Formen der Religion“.
Benedikt XVI. will besonders herausstreichen, daß die Konzilsväter keine andere Kirche wollten. Deshalb „ist eine Hermeneutik des Bruchs des Konzils absurd und widerspricht dem Geist und dem Willen der Konzilsväter“, so der Papst.
Im Mittelpunkt der gleichzeitig tagenden Bischofssynode steht die Weitergabe des Glaubens und damit dasselbe Thema, das der Einberufung des Konzils zugrundelag. Es geht dabei nicht nur darum, wie der Glaube weitergegeben werden kann, sondern darum, welcher Glauben weitergegeben wird. Marx Kardinal Ouellet, der Präfekt der Kongregation für die Bischöfe hielt am Mittwoch eine ausführliche Rede über das Apostolische Schreiben Verbum Domini von 2010, in dem Papst Benedikt XVI. darlegte, daß es ohne Bezug auf die Heilige Schrift keine wahre Weitergabe des Glaubens geben könne. Für Kardinal Ouellet kommt die sichere Verankerung aus dem Lehramt, das die Heilige Schrift korrekt auslegt. Bereits Kurienkardinal Zenon Grocholewski hatte kurz zuvor in seinem Redebeitrag jene Theologie gegeißelt, die sich nicht am Lehramt der Kirche ausrichtet, sondern „andauernd Unsicherheit und Verwirrung säe“, weil sie von jenen vertreten werde, die „versessen darauf sind groß, originell und wichtig zu werden“.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Messa in latino
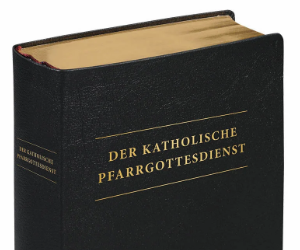

„In einem Buch mit dem Titel ‚Vraie et fausse réforme‘ präsentierte P. Yves Congar als ‚echt‘ eine ‚Reform‘ der Kirche, die sich eher als eine wirkliche Revolution denn eine echte Reform entpuppte. Auf den Dominikaner geht eine der erste Nennungen der Formel ‚Primat der Pastoral‘ zurück, die den Unterschied zwischen den Dogmen und ihrer sprachlichen Formulierung einführte, als ob der Ausdruck der Lehre sich ändern könne, ohne ihren Inhalt unbeschadet zu lassen“. (Roberto de Mattei, Das Zweite Vatikanische Konzil,S. 118) (…)„Man muss keine andere Kirche schaffen…man muss eine andersartige Kirche schaffen“ (Ebd.,).
Schon der junge Theologe Ratzinger verehrte Congar, als Papst hat er ihn unlängst äußerst lobend erwähnt.
Der übermächtige Einfluss der Periti auf die Konzilsväter ist bekannt. Seit Vat. II haben sowieso die Theologen weitgehend das Lehramt übernommen. Sollte der Heilige Vater das Konzil auch mit den ‚Augen Congars‘ sehen, wundert mich nichts mehr.
Eigentlich müsste man die ganze Seite 118 des Buches von Roberto de Mattei zitieren. Dann würde schnell klar, warum der Philosoph Dietrich von Hildebrand schon in den 1970er Jahren die Kirche als „verwüsteten Weinberg“ wahrnahm. Natürlich ist Congar nicht allein verantwortlich, aber er war ein Protagonist. Von Johannes Paul II. in den Kardinalsrang erhoben. Und er hatte einflussreiche Kollegen, auch Karl Rahner zu nennen, reicht nicht aus.
Die Krise der Kirche ist leider auch eine Krise Roms. Ohne die Zusage unseres Herrn, dass „die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen“, wäre die Situation aussichtslos. Unser Herr hat uns allerdings nicht versprochen, dass die äußere Gestalt der Kirche sich nicht ändern kann. Der Glaubenspräfekt Joseph Kardinal Ratzinger sagte voraus, die Kirche werde in Zukunft in kleinen Gruppen überleben. Wenn das so weitergeht, wird das düstere Bild tatsächlich schmerzliche Realität. Noch scheint sie weit entfernt von uns. Noch…
Wie Recht Sie haben! Man hat mit dem V 2 das Kind mit dem Bade ausgeschüttet! Statt den Kern des Glaubens und der Kirche bloßzulegen und sich auf die Tradition im Guten zu konzentrieren, ist man in den 70er Jahren – dem damaligen Zeitgeist entsprechend – zertrümmernd zu Werke gegangen. Und die Folgen? Keine Beichte mehr, kaum noch ein sichtbares sakramentales Priestertum, die Katechse va.auch in der Erstkommunion-Vorbereitung ist verschwunden, etc.etc.
Wir können B XVI mehr als dankbar sein, wenn er nun, endlich! einmal den Drewermännern und Küngs (v.a. letzterem, der lieber Bücher über den Islam schreibt und seit Jahren ein Weltethos konstruiert!) das V2 richtig, nüchtern und sachlich interpretiert und auch die Fehlentwicklungen aufzeigt.